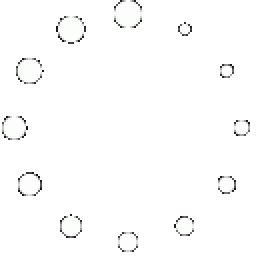Neue Quellen der Staatsausgaben
Franz Rieder • Privateigentum vs. Willkür, eingeschränkt handlungsfähig, aus der Bank in die Maschinenhalle (nicht lektorierter Rohentwurf) (Last Update: 01.06.2019)
Dort, wo mit einmal eine Geldwirtschaft blüht, sind die Egoismen der Macht nicht weit. England war im 17. Jhd. eine rasant aufstrebende Kolonialmacht und nur zu gerne bereit, das Erbe der Fugger und der Bankiers der ersten Stunden fortzuführen. Als oberster Repräsentant des Staates England war König Karl (Charles) I. genau so glaubwürdig in Sachen Geld wie die früheren Bankiers, so meinten seine vermögenden Untertanen; aber da hatten sich die wirtschaftlich erfolgreichen Bürger und Händler jener Zeit schwer geirrt. Sie wähnten ihre Vermögen nirgendwo sicherer als im Londoner Tower, über den der König und die Kolonialmacht England wachten.
Damit war es vorbei im Jahr 1640 n. Chr. Charles brauchte dringend Geld für seinen Krieg gegen Schottland. Als die Schlacht geschlagen und die Söldner bezahlt, waren die Vermögen perdu, so auch das einstige Vertrauen in Tower, Staat und König. Was dann noch übrig war von all‘ dem schönen Gold, landete gegen eine kleine Depotgebühr bei den ansässigen Goldschiedebetrieben zur Aufbewahrung. Das Gold wurde quittiert und damit waren die Goldsmith-Notes und, wie der Schweizer Ökonom Mathias Binswanger trefflich notierte: das „Geld aus dem Nichts“1 erfunden.
Gut zu wissen, dass der Staat, wenn er einmal seine Finger am Geldvermögen seiner Untertanen, dies gilt auch für Bürger in demokratischen Verfassungen, hatte, dies in einer Skrupellosigkeit tut und stets bereit ist, zu wiederholen, natürlich zum Wohle aller, die ihres gleichen suchte und sucht. Was sollen dann auch die Londoner Goldschmiede tun, als weiter Papier zu bedrucken. Papier, auf dem nun die Kreditsumme als eine Zahl steht, und damit hat es sich.
Aus den Goldsmith-Notes wurde das neue Geld, dem kein Gold mehr als ‚Sicherheit‘ hinterlegt war und wenn schon, hatte doch der König selbst der Evidenz Vorschub geleistet, dass die wahren Langfinger in Buckingham Palace oder auf sonstigen Regierungsbänken sitzen. So notiert Binswanger weiter, dass „der Ursprung der modernen Geldwirtschaft“ genau hier in London gefeiert werden sollte wie die Londoner Goldschmiede als die „großen Innovatoren der Menschheit“. Damals stiegen keine Feuerwerke auf in den Himmel zur Feier dieses weltbewegenden Anfangs einer bis heute andauernden Innovation, deren technische Erfordernis gering, deren Bedeutung um so größer war.
Auch heute findet sich kein Anlaß, die Feier nachzuholen oder die ‚Rettung des Euros‘ zu feiern, oder gar die von Griechenland. Damals wie heute haftet am Papiergeld der strenge Geruch des Betrugs. Damals begann seine Geschichte mit einem immensen Betrug an den Bürgern und Händlern des von Gottes Gnaden eingesetzten Machtinhabers und des Staates als dessen willfährigen Erfüllungsgehilfen. Und auf dem Raub folgte eine umfassende Verschleierung und Manipulation, die bis heute das große Misstrauen der Bürger in die politischen Machthaber und deren geldwirtschaftliche Organisationen wie etwa die Notenbanken begründet. All zu oft haben sich Macht und ihre Herrschergehilfen am Vermögen wie am Privateigentum vergriffen oder auf Kosten nachfolgender Generation ihre Selbsterhaltung finanziert.
Wir erkennen schon bis hier hin nur, dass ein großer Irrtum wäre, Privatvermögen, Staat und Geldwirtschaft in einen Topf zu werfen. Mögen auch alle den Schein erwecken, zusammen zu gehören, es stimmt nicht. Schon gar nicht unter einem Begriff wie der des Kapitalismus‘. Im England des 17. und 18. Jahrhundert, das auch Smith und Marx vor Aufen schwebte, vollzog sich ein Wandel, der beachtet werden will. Wirtschaft und Geldwirtschaft traten nämlich auseinander, das einst bis zum Tode verbundene Paar wurde eine lockere Lebensgemeinschaft, ja sogar ein ‚Single Haushalt‘.
Verstand man bis dato Wirtschaft als eine Form der Haushaltsführung, indem jeder sein Vermögen aufbaute, sicherte und verwaltete bzw. verwalten ließ, so war das Vermögen immer verbunden mit der wirtschaftlichen Tätigkeit eines Bürgers bzw. eines konkreten Händlers. Es mehrte sich aus dieser Quelle, aus der es ursprünglich geschöpft wurde. Mehr Handel, mehr Tausch und Geldwirtschaft im ursprünglichen Sinne hieß prinzipiell mehr Vermögen; meist auch tatsächlich.
Das alte System bedeutete, mehr Güter gleich mehr Werte. In dem aufkommen neuen System der Geldwirtschaft löst sich diese Verbindung. Mehr Werte waren nicht mehr notwendig und symmetrisch an mehr Güter gekoppelt. Die Entkoppelung der Wirtschaft von bereits Vorhandenem, den Gütern und Märkten, erzeugte ein System von Möglichkeiten, Erwartungen und Wahrscheinlichkeiten, dem die Banken immer mehr und immer schneller als Grundlage dienten. Alles Geld, so Binswanger, ist seither nichts weiter als „eine Schuld der Banken (…). Die finanzielle Revolution ging der industriellen Revolution voraus.“
Die neue Geldwirtschaft erschien als ein System, mit dem man bilanziell wie real Werte schaffen konnte, ohne das zu verkaufen bzw. in ein Handelssystem zu geben, was defacto auch da war. Und die neue Geldwirtschaft als ein eigener Wirtschaftsraum machte möglich, ohne Vermögen anzusparen zu investieren. Es hatte also diesen entscheidenden Zeitvorteil, in ein Wachstum zu investieren, welches allein auf dem Boden des Möglichen wie des Wahrscheinlichen, also rein virtuell existierte, auf dem die Erwartungen an zukünftige Renditen gründeten und auf dem Banken ihre enormen Geschäftschancen identifizierten.
Mit
diesen Geschäftschancen der Banken stieg die Anzahl der Quellen
für eine Staatsfinanzierung enorm, zumal im Mittelalter die
Quelle der Lohnsumme noch nicht sonderlich erwähnenswert war und
die Finanzierung von Kriegen weiter wuchs. Geld war da und so folgte
Krieg auf Krieg. Auf den anglofränzösischen, auch
Hundertjähriger Krieg genannt, zwischen 1337 bis 1453, folgte
der Dreißigjährige Krieg, in dem gemeinsam mit ihren
jeweiligen Verbündeten im Reich die habsburgischen Mächte
Österreich und Spanien ihre dynastischen Interessenkonflikte mit
Frankreich, den Niederlanden, Dänemark und Schweden
austrugen.
Infolgedessen verbanden sich eine Reihe weiterer Konflikte mit dem Dreißigjährigen Krieg: der Achtzigjährige Krieg (1568–1648) zwischen den Niederlanden und Spanien, der Französisch-Spanische Krieg (1635–1659) und der Torstenssonkrieg (1643–1645) zwischen Schweden und Dänemark, um nur an die bekanntesten zu erinnern und ohne den „Schwarzen Tod“, die Pest, zu vergessen. Kriege und Pest hatten weitreichende Folgen auf das Menschenbild und die Wirtschaft in Europa; ein kurzer Exkurs erinnert daran.
Pestialische Aufklärung
Natürlich hat die osmanische Herrschaft in Al Andalus einen wesentlichen Beiträg zur Aufklärung und dem Anbruch der Renaissance in Europa beigetragen. Wir lenken den Blick aber hier auf ein anderes Ereignis, welches weit mehr war als ein Ereignis, nämlich ein fundamentaler Einschnitt in eine, vom damaligen Katholizismus geprägten geistigen Übereinkunft und einer wirtschaftlichen Realität, die den Alltag der überwiegenden Mehrzahl der Bürger der europäischen Staaten bestimmte, die Pest.
Die Pest oder der „Schwarze Tod“2 wütete von 1347 bis 1353, verwüstete ganze Landstriche, verschonte wenige. Zwischen 900 bis 1300 vervierfachte sich die Bevölkerung in Europa durch Urbarmachung von Land, dem Wachstum der alten und dem Entstehen zahlreicher neuer Städte. Die europäische Gesellschaft vor dem Jahr 1300 entwickelte eine hoch effektive Geldwirtschaft, besaß gut ausgestattete Universitäten, errichtete beeindruckende gotische Kathedralen und erlebte eine künstlerische und literarische Blütezeit. Zwischen 1214 und 1296 behinderte vor allem in Westeuropa kein größerer Krieg deren Weiterentwicklung.
Ab dem Jahr 1290 verzeichneten weite Teile Europas lang anhaltende Hungersnöte. Die Untersuchungen der Entwicklung des Weizenpreises im englischen Norfolk lassen darauf schließen, dass es zwischen 1290 und 1348 neunzehn Jahre gab, in denen der Weizen knapp war. Für das französische Languedoc ergeben ähnliche Untersuchungen zwanzig Jahre mit Knappheit an Nahrungsmitteln im Zeitraum von 1302 bis 1348. 1315 bis 1317 waren in ganz Nordeuropa Hungerjahre. In den Jahren 1346 und 1347 herrschte Hunger in Süd- und Nordeuropa. Bereits 1339 und 1340 traten in italienischen Städten Seuchen auf, was zu einem deutlichen Anstieg der Sterblichkeit führte.
Historiker
gehen allgemein davon aus, dass etwa 20 bis 25 Millionen Menschen,
rund ein Drittel der damaligen Bevölkerung Europas, durch den
„Schwarzen Tod“ umkamen, anderer Forschen sprechen sogar
von 40-50%.„Die
Tendenz der jüngeren Forschung deutet darauf hin, dass eher
45-50 % der europäischen Bevölkerung während eines
Zeitraums von vier Jahren starb. Es gibt beträchtliche
geographische Unterschiede. In den Mittelmeerregionen Europas,
Gebieten wie Italien, Südfrankreich und Spanien, wo die Pest
vier Jahre lang grassierte, starben wahrscheinlich etwa 75-80 % der
Bevölkerung. In
Deutschland
und England … lag die Todesrate wahrscheinlich näher bei
20 %.“3
Ein
direkter Effekt des „Schwarzen Todes“ war, dass viele
Menschen ihn anfänglich als eine Art Gottesstrafe ansahen und
Trost im Glauben suchten. Religiöse Bewegungen entstanden
spontan im Gefolge oder in Erwartung der Seuche und viele davon
forderten das Monopol der Kirche auf geistliche
Lenkung der Gesellschaft und des einzelnen Menschen heraus.
Bittgottesdienste und Prozessionen kennzeichneten den Alltag.
Flagellanten4
zogen in „Geißlerzügen“ durch die Städte.
Der „Pestheilige“ St. Rochus wurde intensiv verehrt,
Pilgerfahrten nahmen zu. An vielen Orten zeugen Kirchen und andere
Monumente wie sogenannte Pestsäulen von der Angst der Menschen
und ihrem Wunsch nach Erlösung von der Seuche.
Aber was
erlebten die Menschen von Kirche und weltlicher Macht? Der
italienische Chronist Matteo Villani schrieb:
„Die
Menschen, in der Erkenntnis, dass sie wenige und durch Erbschaften
und Weitergabe irdischer Dinge reich geworden waren, und der
Vergangenheit vergessend, als wäre sie nie gewesen, trieben es
zügelloser und erbärmlicher als jemals zuvor. Sie ergaben
sich dem Müßiggang, und ihre Zerrüttung führte
sie in die Sünde der Völlerei, in Gelage, in Wirtshäuser,
zu köstlichen Speisen und zum Glücksspiel. Bedenkenlos
warfen sie sich der Lust in die Arme.“
Die kirchlichen Institutionen waren hilflos gegenüber der Pest, die Kirche selbst verlor zunehmend an Autorität. Was aber schwerer wog, war, dass sie weder eine zufriedenstellende Antwort auf die Frage fand, warum Gott der Menschheit eine solche Prüfung auferlegt hatte, noch hatte sie geistlichen Beistand geleistet, als das Bedürfnis der Menschen danach am größten war. Die Bewegung der Flagellanten hatte die Autorität der Kirche auf die Probe gestellt. Auch nach dem Abklingen dieser Bewegung suchten viele Gott bei mystischen Sekten und in Reformbewegungen, was letztlich die katholische Glaubenseinheit auseinanderbrechen ließ.
Insbesondere
der österreichische Kulturhistoriker Egon Friedell, der eine
direkte, kausale Verbindung zwischen
der Katastrophe des „Schwarzen Todes“ und der Renaissance
sieht, vertrat in seinem Werk Kulturgeschichte
der Neuzeit
die Auffassung, dass die Seuche der Jahre 1348/49 die Krise des
mittelalterlichen Welt- und Menschenbildes verursacht und bis dahin
bestehende Glaubensgewissheiten erschüttert habe. Vor allem der
Glaube an die Gleichheit der Menschen vor Gott war angesichts von
Elend und Tod in einem solchen Ausmaß im Diesseits von diesem
vollends ins Reich des Jenseits, in die Welt nach dem Tod verschoben.
Im Diesseits war Gleichheit nicht mehr zu
erreichen.
Dazu
kam noch, dass die Kirche, von zahlreichen Seuchenopfern als Erbe
eingesetzt, schlussendlich reicher aus der Zeit des „Schwarzen
Todes“ hervorging, was ihr gesteigerte Unpopularität
einbrachte.
Mit der weltlichen Macht verhielt es sich ähnlich. Nach der Pest war alles anders. Der Bevölkerungsrückgang erzwang eine radikale Veränderung im Wirtschaftsleben, die sich bald als vorteilhaft in vielerlei Hinsicht erweisen sollte5 . Bewährte soziale, kulturelle und ökonomische Verhaltensweisen aus der Zeit vor der Pest verloren an Bedeutung aufgrund massiver Veränderungen an ihren tragenden Säulen. Die Entvölkerung ermöglichte einem größeren Prozentsatz der Bevölkerung den Zugang zu Bauernhöfen und lohnenden Arbeitsplätzen. Unrentabel gewordene Grenzböden wurden aufgegeben, was in manchen Regionen dazu führte, dass Dörfer verlassen oder nicht mehr wiederbesiedelt wurden (sogenannte Wüstungen), die im Hochmittelalter im Zuge des Landesausbaus abgeholzten Wälder breiteten sich wieder aus.
Die Zünfte ließen nun auch Mitglieder zu, denen man zuvor die Aufnahme verweigert hatte. Während der Markt für landwirtschaftliche Pachten zusammenbrach, stiegen die Löhne in den Städten deutlich an. Damit konnte sich eine größere Anzahl von Menschen einen höheren Lebensstandard leisten als jemals zuvor; allerdings kam es teilweise auch zur Nahrungsmittelknappheit, weil viele Felder nicht mehr bewirtschaftet wurden, so z.B. in England, wo die Löhne für Landarbeiter stark anstiegen.
Obwohl die Adeligen 1349 im Parlament das ‚Statute of Labourers‘ durchsetzten, das die Löhne für Feldarbeit begrenzte, wurden die Landarbeiter zusätzlich mit Naturalien bezahlt6 . Die Lohnkonflikte führten schließlich zum großen Bauernaufstand von 1381, der (Peasants’ Revolt), in dessen Folge England als erstes Land Europas die Leibeigenschaft abschaffte. Freie Bauern wurden in der Folge durch Pächter ersetzt, die weniger arbeitsintensive Schafzucht verdrängte den Ackerbau.
Der deutliche Anstieg der Arbeitskosten sorgte dafür, dass manuelle Arbeit zunehmend mechanisiert wurde. Damit wurde das Spätmittelalter zu einer Zeit eindrucksvoller technischer Errungenschaften. Das wohl bekannteste Beispiel ist der Buchdruck: Solange die Löhne von Schreibern niedrig waren, war das handschriftliche Kopieren von Büchern eine zufriedenstellende Reproduktionsmethode. Mit dem Anstieg der Löhne setzten umfangreiche technische Experimente ein, die letztlich zur Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg führten.
Privateigentum vs. Willkür
Die neue Geldwirtschaft war ein entscheidender Faktor für anhaltendes Wachstum in Europa. Kriege und Pest werden aus heutiger Sicht als „Krisen“ im wirtschaftlichen Bedeutungszusammenhang betrachtet. Kriege in direktem Bezug zur Geldwirtschaft, insofern sie mit enormen Finanzierungskosten und -risiken einher gingen, die Pest in direktem Bezug zu den Arbeitsmärkten, insofern sie einen drastischen Bevölkerungsrückgang zur Folge hatte. Dass sich hier die Auswirkungen von Pandemie und Kriegen überschneiden und nicht klar voneinander zu trennen sind, ist einsehbar.
Aber wie wir angesprochen haben, sind, so schrecklich die Pest und der Krieg auch sein mögen, aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht beide so leicht nicht als Krise zu beurteilen. Ohne gleich den Krieg als „Vater aller Dinge“ wie dies Heraklit verstand, zu mystifizieren, so hat der Dreißigjährige Krieg und der „Schwarze Tod“ im Mittelalter viele geistige und weltliche Ordnungsstrukturen wieder ‚in Fluß‘ gebracht. Weder waren die bewegenden, produktiven Kräfte vernünftige oder ökonomische; geradezu anders herum, waren vernünftige und ökonomisch fortschrittliche Auswirkungen gegründet auf Grausamkeit, Tod, Leid und Elend.
Wir haben gezeigt, dass die Geldwirtschaft im Mittelalter zum Schutz des Handels wie des Bürgers, nicht allein, aber überwiegend zum Schutz deren Privateigentums entstanden war. Diese Schutzfunktion, die auch Leib und Leben der Händler schützte, richtete sich seit den sog. Goldsmith-Notes auch gegen staatliche Willkür. Aber durch den Fortschritt der Geldwirtschaft und der Erfahrung staatlicher Willkür, wie leicht doch an das Vermögen der Bürger heranzukommen war, entwickelte sich zunehmend die staatliche Kontrolle über die Geldwirtschaft.
Gleichwohl bei vielen der Staat Glaubwürdigkeit und Vertrauen in Sachen Geldwirtschaft verloren hatte, markiert das Jahr 1742 den entscheidenden Einschnitt in die bisherige Geldwirtschaft in Frankreich und kurze Zeit später auch in England. Im Auftrag des Staates druckte der Schotte John Law in Frankreich Unmengen an Papiergeld, um die enormen Schulden, die der Staat Frankreich angesammelt hatte, los zu werden. Er machte anfangs auch gute Geschäfte mit dem Versprechen auf hohe Profite in den französischen Überseekolonien, die, wenn man so will, so gut sich entwickelten, dass eine Blase unter der Bezeichnung: ‚Mississippi Spekulation‘ sich entwickelte, die 1720 platzte und voll auf die Kosten der Aktionäre ging.
Den Einbruch des damaligen Finanzmarktes überlebte das Ancien Régime so gerade noch. Beim nächsten Mal, 70 Jahre später, im Mai 1789, ging die Geldgier des Staates ins Auge. Der König wollte die Steuern erhöhen, weil das Budgetdefizit enorm war, doch er sah sich zur Einberufung der Generalstände gezwungen, womit der kostspielige Absolutismus faktisch am Ende war. Das war der Beginn der Französischen Revolution.
In
England war es ausgerechnet die rechtliche und institutionelle
Nachfolgerin der Münzstätte im Londoner Tower, die
staatliche Bank of England, die im Jahr 1742 das Monopol zur
Banknotenausgabe erhielt. Von da an kontrollierte also der englische
Staat die Geldwirtschaft. Der tat dies nicht mit der französischen
Hasardeur-Mentalität, stand aber um so mehr in direkter Nähe
zur englischen Krone.
Bei der Gründung der Bank of England im
Jahr 1694 gab es bereits einen unmittelbaren Zusammenhang zu den
finanziellen Defiziten von König William III. Dieser benötigte
dringend Kapital für den Krieg gegen Frankreich und den
vertriebenen König Jacob II. Ihr Privileg zum Gelddrucken war
gebunden an einen festen Zinssatz, zu dem sich der Staat bzw. die
Krone verschulden konnte und wurde mehrfach in einem ca.
zwanzigjährigen Rhythmus gegen eine üppige Auszahlung an
den Staat erneuert.
In Folge dessen waren auch entsprechende Erhöhungen des Aktienkapitals notwendig und die Entwicklung der Bank of England, ihre Expansion also ganz wesentlich verbunden mit der wiederholten Verlängerung ihres Privilegs und des Geldbedarfs des Staates, der schließlich die Bezeichnung: Staatsschulden erhielt. Durch ihre Privilegien in allen geldwirtschaftlichen Angelegenheiten in England, die über die Kontenführung der Regierung wie deren darlehnsbasierte Finanzierung in Kriegs- wie in Friedenszeiten hinaus eine Reihe anderer Dienste, etwa Immobilienfinanzierung, Ausgabe von Banknoten, Einlagensicherung etc. umfasste, fiel ihr 1781 der Status eines staatlichen Schatzamtes (Treasury) zu, wurde sie zur Bank aller Banken, was wir heute eine Notenbank resp. Zentralbank nennen.
War
damals das Vertrauen in die Bank of England auf dem Zenit, so verlor
sie es bis zum 1. Mai 1821. Durch den Krieg mit Frankreich
erschöpften die finanziellen Beziehungen zum Staate die Mittel
der Bank, so dass sie im Februar 1797 bei einem Notenumlauf von
8.644.250 Pfund nur ein Barvermögen von 1.272.000 Pfund besaß.
So ließ sie sich durch die Regierung mittels einer
Kabinettsorder vom 26. Februar 1797, die später die Bestätigung
des Parlaments erhielt, von der Barzahlung befreien7 .
Premierminister
William Pitt der Jüngere gab 1797 zur Finanzierung des Kriegs
gegen Frankreich Papierbanknoten aus, um die Goldreserven des
Königreichs zu schützen. Das erhöhte die
Staatsschulden, und bald musste auch erstmals eine Einkommensteuer
eingeführt werden.
In dieser Epoche der Uneinlösbarkeit
der Banknoten oder der sog. „Bankeinschränkung“
(bank-restriction), die letztlich bis 1. Mai 1821 dauerte, haben die
Noten beim Umtausch gegen bar ein ansehnliches Disagio8
von bis zu 30 Prozent verloren.
Wir können festhalten: Die Kontrolle der Geldwirtschaft durch den Staat funktioniert nur solange, wie der Staat Glaubwürdigkeit und Vertrauen – wie bei einer Bank – in die Geldwirtschaft als ein Geschäftsmodell für private Anleger nicht beeinträchtigt. Hier liegt auch der Grund für die heutige „Unabhängigkeit“ nationaler Notenbanken bzw. der europäischen Notenbank (EZB) und der US-amerikanischen Fed. In ihren Funktionen als sog. Treasuries, also staatlichen Schatzämtern haben die Banken bzw. Notenbanken dieses Vertrauen nicht und wurden im Laufe der Zeit als solche auch abgeschafft. Die Bank of England wurde 1946 sogar verstaatlicht und übernahm alle Funktionen einer Zentralbank, vor allem die Sicherung der Preisstabilität und setzt seit 1997 die amtlichen Leitzinssätze für die englische Geld- und Kreditpolitik fest. Ein Engagement im privaten Finanzsektor hat die Bank of England mittlerweile eingestellt. Ihr Direktorium besteht seit 1998 aus einem Bank-Gouverneur, zwei Vizegouverneuren und 16 Direktoren, wobei der Gouverneur für die Zentralbankpolitik verantwortlich ist und diese gegenüber dem Schatzkanzler zu vertreten hat. Der Schatzkanzler selbst hat zur Wahrung des öffentlichen Interesses ein Weisungsrecht gegenüber der Bank of England.9
Über lange Zeiträume hinweg war die Bank of England das Masterpice für alle Notenbanken in Europa und den USA. Leider auch für die Schattenseiten des staatlich gelenkten Notenbankwesens. Nach ihrer Verstaatlichung wurden die Altaktionäre abgefunden, die Bank jedoch kam durch die Abwertung in Folge des Abkommen von Bretton Woods und dann 1967 in Folge der schlechten Wettbewerbsposition und Leistungsbilanz Englands im Welthandel immer wieder in Schwierigkeiten. Ihre Zahlungsbilanz verschlechterte sich zunehmend und in den 1980er Jahre hatte die Bank eine Schlüsselrolle in verschiedenen Bankenkrisen inne. Die Bank war vorn dabei, als die Geldpolitik wieder zentraler Bestandteil der Regierungspolitik in den 1980ern, bis sie schließlich ab dem Jahr 1997 operational unabhängig wurde und dem Vorbild anderer Notenbanken folgte.
Heute sehen wir die Bedeutung, die eine unabhängige Notenbank besonders in Zeiten von Finanz- und großen Konjunkturkrisen besitzt. Am Beispiel der FED für den US-Dollar und der EZB für den EURO. Aber besitzen die Notenbanken wirklich Unabhängigkeit von staatlichen Eingriffen? Staatlichen Einflüssen, so sie politisch vernünftig und gewollt sind, ist wenig entgegen zu bringen; aber Eingriffe manifestieren Grade der staatlichen Kontrolle, Manipulation und Missbrauchs.
Eingeschränkt handlungsfähig
Das Dilemma der Notenbanken
Die Unabhängigkeit der Notenbanken soll den Schutz des Privateigentums der Bürger und Wirtschaftssubjekte einer Volkswirtschaft bzw. eines supranationalen Wirtschaftsraumes wie die Europäische Union und deren Währung, den Euro, vor staatlichen Eingriffen schützen. Sie schützt also als ein gleichsam nachgeordnetes Ziel die auf Privatvermögen basierende Wirtschaftsordnung vor staatlichen Eingriffen und politischer Manipulation, indem sie für Preisstabilität einerseits und nachgeordnet durch die Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik in der politischen und wirtschaftlichen Gemeinschaft, aber ohne dabei die Preisstabilität zu beeinträchtigen.
Wir erkennen daran, dass dem vorrangigen Ziel der Preisstabilität das wirtschaftliche Wachstum nach- bzw. untergeordnet ist. Wachstum um jeden Preis ist nicht im Statut der Notenbanken verankert. Bereits mit der Gründung der Amsterdamer Wechselbank im Jahr 1609 und dem Aufbau eines Netzwerkes aus öffentlichen Girobanken in Mittel- und Südeuropa wurden jene Funktionen, die heute die Notenbanken ausüben, ohne Notenbanken, oder wie man heute sagt, ohne Lender of last resort wie etwa eine FED oder EZB, sichergestellt.
Die Girobanken zu deren Netzwerk die Hamburger Bank, der Banco Giro in Venedig und der Nürnberger Banco Publico zählten, stellten damals bereits eine öffentliche Infrastruktur für bargeldlose internationale Zahlungen zur Verfügung10 , die Wachstum im Sinne einer Steigerung der Effizienz des damaligen Handels und Geldwertstabilität, also das Funktionieren der damaligen Geldwirtschaft gewährleisteten. Die Girobanken aus jener Zeit erfüllten somit bereits wesentliche Funktionen moderner Zentralbanken, ohne eine Zentralbank zu sein.
Wenn Hayek forderte, die Aufgaben der Zentralbanken zu dezentralisieren und also wieder in private Hände zu geben, was unter dem Terminus: ‚Free Banking‘ heute wieder zur Diskussion kommt, dann erinnert er indirekt an die Zeit der Girobanken am Anfang des 17. Jahrhunderts in Europa. Und bei Hayek wie bei Mise, beide Vertreter der Österreichischen Schule, wird den Grund für die zyklisch wiederkehrende Instabilität der Wirtschaft darin gesehen, dass eine den Notenbanken eine expansive Geldpolitik, wie wir sie nun seit über zehn Jahren bestätigt sehen, sowohl in den USA wie in Europa, politisch aufgezwungen wurde.
Das erinnert nicht nur an die Bank of England und ihre Vorläufer, auch die Schwedische Reichsbank, die als die älteste heute noch existierende Zentralbank gilt, wurde 1656 , als sie noch als Stockholms Banco firmierte, zwar von der schwedischen Regierung als private Einrichtung zugelassen und trotzdem unterlag sie einer starken staatlichen Lenkung11 . Die Regierung platzierte den größten Teil ihres Vermögens in der Bank und forderte gleichzeitig, dass entstehende Gewinne mit der Stadt Stockholm und dem Staat geteilt werden.
Wenn
heute die Unabhängigkeit der Notenbanken auch dazu dient, eine
zu expansive Geldpolitik von Regierungen zu unterbinden bzw. über
die Zinspolitik zu verhindern, dass es zu Investitionen in an sich
unrentable Projekte kommt, die früher oder später
bereinigt, sogar abgewickelt werden müssen, dann ist die
Unabhängigkeit der Notenbanken auch in dieser Funktion nur
eingeschränkt gegeben, sie nur beschränkt handlungs- bzw.
geschäftsfähig.
Wir haben vermerkt, dass Notenbanken wie
Banken generell ganz wesentlich von der Glaubwürdigkeit als
Geschäftsmodell leben. Wenn aber eine Notenbank auf Druck von
Regierungen eine expansive Geldpolitik wie etwa die EZB betreibt,
dann werden in der Regel die negativen Folgen diese expansiven
Geldpolitik nicht der Regierung, sondern der Notenbank selbst
angelastet.
Regierungen sind in Hinsicht auf die Politik der Notenbanken mehr oder weniger manipulativ. Eine Zentralbank kann von den Weisungen der Regierung unabhängig sein, beispielsweise wurde das vor der Finanzkrise von der Deutschen Bundesbank und der US-amerikanischen FED gesagt, sie kann aber auch von der Staatsregierung weisungsgebunden sein wie etwa die Banca d’Italia oder die People’s Bank of China. Ist eine Zentralbank von Weisungen der Regierung abhängig, so ist der Staat der eigentlich Verantwortliche für die Geld- und Währungspolitik.
Heute
müssen wir feststellen, dass die Eingriffe des Staates in die
Autonomie der Zentralbanken enorm zugenommen haben. Dabei ist nicht
nur der Grad der Verflechtung der Zentralbanken mit Wirtschaft und
Politik ausschlaggebend, sondern auch weitere Faktoren.
Preisniveaustabilität ist das vorrangige Ziel der
supranationalen EZB. Da ihr diese Aufgabe durch den Vertrag von
Maastricht vorgeschrieben ist, befindet sich die EZB in einer
Zielabhängigkeit.
In Bezug auf die Realisierung dieses Ziels
durch den Einsatz verschiedener geldpolitischer Instrumentarien ist
sie jedoch weisungsunabhängig, d.h. sie besitzt
Instrumentenunabhängigkeit.
Unter
Zielabhängigkeit – goal dependence – versteht man,
dass die Regierung die Ziele der Zentralbank
beeinflussen kann. Ist bspw. die Preisstabilität als oberes Ziel
der Zentralbank gesetzlich vorgegeben, liegt eine Zielabhängigkeit
vor. Kann die Zentralbank hingegen ihre Aufgaben selbst festlegen,
handelt die Zentralbank zielunabhängig12 .
Unter
Instrumentenabhängigkeit
– instrument dependence – versteht man, in welchem Maße
die Regierung die Zentralbank bei der Zielerreichung beeinflusst. Ist
die Zentralbank bei der Wahl ihres geldpolitischen Instrumentariums
weisungsabhängig, d.h. entscheidet die Regierung, welche
Instrumente bei der Erreichung der Geldwertstabilität eingesetzt
werden, spricht man von Instrumentenabhängigkeit.
Kann die Zentralbank ihre geldpolitischen Instrumente frei wählen,
handelt sie instrumentenunabhängig (ebenda).
Seit dem 19. März 2015 haben die EZB und 18 nationale Notenbanken der Eurozone für mittlerweile mehr als 2500 Mrd. Euro Staatsanleihen aufgekauft, eine Daueraktivität, die sowohl was die Ziele wie auch die Instrumente der Geldpolitik der Notenbanken betrifft sich kaum klar voneinander unterscheiden lassen; sicher ist nur, dies geschah nicht auf der Grundlage der Unabhängigkeit der Notenbank von der Politik, letztlich dem Europäischen Ministerrat, der die Regierungen der EU-Länder versammelt. Und gleichzeitig war es eben dieser Ministerrat, der mit dem Euro-Stabilitätspakt nicht nur Ziele und Instrumente in der europäischen Geldpolitik der Notenbank ausdehnte, sondern eine extrem expansive Geldpolitik einleitete, wobei das Geld, das die Zentralbanken ausgaben, kein gedrucktes Geld war, aber doch Geld, das bei den nachgeordneten Ausreichern, im wesentlichen Banken und Versicherungen, auf Konten gutgeschrieben wurde und das sie wiederum für den Kauf anderer Anleihen oder von Aktien nutzen konnten. Man hoffte zwar, dass dieses Geld ganz klassisch für die Vergabe von Krediten würde genutzt werden, dazu kam es aber weniger und dies war ein Grund neben anderen, dass die angestrebte Preisstabilität lange Jahre weit unterhalb der gewünschten Zwei-Prozent-Grenze verblieb.
Im Endeffekt its genau das eingetreten, was weder Aufgabe und Funktion einer Notenbank war und ist, die EZB und die nachgeordneten Notenbanken sind heute die größten Gläubiger ihrer Heimatstaaten und also ihrer Regierungen, eine Situation, die aus der Geschichte der Notenbanken viel Aufwand benötigte, um sie zu vermeiden, und die auch bei der Einführung des Euro und dem Euro-Stabilitätspakt sicher nicht im Interesse der Bevölkerungen, der Bürger als Sparer und Versicherungskunden wie der Wirtschaft stand.
Man muss allerdings erinnern an das Jahr 2014, als in weiten Teilen der Eurozone die Wirtschaft stagnierte , in manchen Ländern die Preise in einem hohen Ausmaß fielen und den Regierungen wenig bis nichts an wirtschaftspolitischen Maßnahmen einfiel, um diesen Weg in eine veritable Wirtschafts- und Politikkrise zu verhindern. Bis dahin zählten Anleihekäufe, oder wie man in Anlehnung an die Politik der FED sagte, Quantitative Easing, kurz QE genannt, zu den unkonventionellen, geldpolitischen Maßnahmen, weitgehend unbekannt in Wirkung und Risiko und daher nur in allergrößter Not anzuwenden. Auf der anderen Seite der Notenbanker, gestützt von weiten Teilen der Ökonomik, fürchtete man den Tag, an dem man das QE-Programm würde wieder zurückfahren müssen. So standen sich diese, die explodierende Zinsen später und jene, die explodierende Preise und politisches Chaos unmittelbar fürchteten unvermittelbar gegenüber und tun es heute noch. Wer letztlich bestimmte, das Anleihekaufprogramm auszuweiten, war von 2105 an der Präsident der EZB. Dass dabei der Rat der europäischen Regierungen eine entscheidenen Rolle mit gespielt hat, wurde kaum gesehen und wenn, wieder vergessen.
Aus der Bank in die Maschinenhalle
Wie man aus heutiger Sicht weder Wachstum ohne den immensen Einfluss der Notenbanken bestimmen kann, so bleibt auch die Technische Entwicklung, die maßgeblich zum Wachstum beiträgt, ohne Geldpolitik und Finanzmärkte unbestimmt. Es fehlten ohne sie nicht einige Eigenschaften von Wachstum und Technischer Entwicklung, sondern der Kern eines adäquaten Verständnisses. Wollte man Technik aus einem ontisch-ontologischen Zusammenhang verstehen, als wäre Technik ein „Zuhandensein“, dann stünde diese Art von Erkenntnis auf der intellektuellen Stufe und Komplexität mit den Menschen, als sie mit einem Steinwerkzeug die Knochen der Mammuts zertrümmerten, um an das nahrhafte Mark zu kommen.
Immerhin, in einer Angelegenheit war der Werkzeugmensch im Vorteil; er brauchte kein Verständnis, nicht einmal ein Bewusstsein über die vielfältigen Einflüsse einer Gemeinschaft, die Wachstum und Technische Entwicklung mit bestimmen. Über die Geldpolitik, vor allem der Notenbanken, nehmen Staaten durchaus an den Entwicklungen auf den Märkten teil und es gibt nicht wenige Wissenschaftler, die der Auffassung sind, dass mit dem durch Beteiligung von Notenbanken und Geschäftsbanken gleichermaßen sich entwickelnden Mischgeld-Systems13 sowohl die Geldwertstabilität wie auch die Steuerung der Inflation schwieriger, ineffektiver geworden ist, als durch ein System marktförmiger Geldschöpfung. Dort, nach einem marktwirtschaftlichen Modell des Mehrbankensystems ohne Zentralbank fände eine systembedingte Kontrolle der Geldschöpfung statt.
Die hätte den Vorteil, dass die gegenwärtigen Beschränkungen durch Barreserven der Geschäftsbanken, die mit einer Auszahlung der gewährten Kredite rechnen und diese Auszahlung in Form des gesetzlichen Zahlungsmittels vornehmen müssen und der Mindestreserve, also der Menge an Zentralbankgeld, die die Zentralbank den Geschäftsbanken, abhängig von deren Kreditvergabe vorschreibt, weg fielen. Gerade diese Beschränkungen aber, so die Wissenschaftler, führten zu geldmengeninduzierten Finanzkrisen, da die Zentralbank durch fast planwirtschaftliche Geldmengensteuerung in den Wettbewerb eingreife.
Drei Vertreter der Wissenschafts-begründeten Gegenposition, Dowd, von Mises und von Hayek, kommen aus unterschiedlichen Ansätzen zu dem gleichen Ergebnis: dass periodisch wiederkehrende Wirtschaftskrisen nur zu verhindern seien, wenn man auf die Ankurbelung der Wirtschaft durch die Bankpolitik verzichten würde. Vielmehr sollte der Zinsfuß durch den Marktmechanismus geregelt werden.
Dowd vertrat bereits 1994, also weit vor der Finanzkrise 2007/8 die Ansicht, dass das Finanzsystem ohne staatliche Eingriffe stabiler sei als es in seiner jetzigen Form ist. Es sei, entgegen verbreiteter Annahmen, in sich stabil und benötige weder einen Lender of last resort noch ein staatliches Einlagensicherungssystem14 . Er legte damals schon die Finger in die Wunde, dass Notenbankpolitik Politik nicht ersetzen kann, was man heute im Verlauf der Krise der EU mit verblüffender Richtigkeit erkennen muss.
1949 vertrat Ludwig von Mises die Auffassung, dass die zyklischen Auf- und Abschwünge der Wirtschaft und damit auch die Entstehung von Depressionen, das Ergebnis der Senkung des Zinssatzes durch die Expansion von Krediten seitens der Banken ist15 . Was seit dieser Zeit als Überinvestitionstheorie bezeichnet wird, beschäftigt sich mit dem Phänomen, dass mit zusätzlich zur Verfügung stehenden Darlehen versucht werde, die Konjunktur künstlich zu beleben mit der Gefahr, dass dadurch Kredite in Wirtschaftszweige und Geschäfte fließen, die vor der Senkung des Zinssatzes als unrentabel erschienen. Eine so angekurbelte Wirtschaft wird früher oder später zusammenbrechen bzw. Schaden erleiden, zumal diese Form der Krediterweiterungspolitik von Banken eine Fehlallokation der Unternehmenstätigkeit zur Folge hat und also ein marktregulierter Zinssatz einem Banken-regulierten unbedingt vorzuziehen ist.
Wenn wir von einem investitionsgetriebenen Wachstum der Wirtschaft gesprochen haben und im weiteren Verlauf sprechen werden, dann müssen wir feinsilbig darauf achten, ob wir, wie im Thema Technischer Fortschritt nicht in eben diesen oben aufgezeigten, problematischen Kontext geraten. Exemplarisch dafür mag die Zeit zwischen 1995 und 2000 stehen, als Banken Aktienkäufe mit schier hochriskanten Titeln und Gewinnerwartungen, teils sogar über Kredite am sog. Neuen Markt finanziert haben.
Bereits 1976 hat von Hayek auf diesen Zusammenhang indirekt hingewiesen, insofern er den Grund für die Instabilität der Wirtschaft darin sah, dass eine expansive Geldpolitik in einem nicht zu vertretenden Ausmaß zu unrentablen Investitionen führt. Eine Ursache für die expansive Geldpolitik bestand für von Hayek darin, dass die Verfügbarkeit des Geldes nicht durch den Marktprozess bestimmt, sondern durch die Zentralbanken reguliert wird16 und forderte deshalb, die Aufgaben der Zentralbanken in private Hände zu geben und zu dezentralisieren.
Wir aber behalten, dass wirtschaftliches Wachstum in den Jahren der industriellen ‚Revolution‘ fast immer in den Räumen der Privatbanken begann, die prall gefüllt mit Kreditgeld waren, je geringer das Zinsniveau ausfiel. Und für das Zinsniveau sorgten die Notenbanken. Beide waren fast allein zuständig für die Schaffung immenser Summen an Buchgeldern, denen auf der anderen Seite der Bankbilanz stramm die endlose Liste an Schuldnern stand; die meisten gute, aber auch wenige toxische Kredite, so zumindest in der Geschichte bis zum Jahr der großen Finanzkrise 2007. Diese Schuldner, von denen wir hier sprechen, waren Sachwalter von Umlauf- und Anlagekapital in den Firmen, aber vor allem waren sie die Triebkräfte der Marktwirtschaft, verpflichtet, ihre Schulden durch die Renditen ihrer Investments zu begleichen und ihre Unternehmen zu entwickeln und im Wettbewerb zu behaupten. Nimmt man diesen Schuldnern Liquidität, die sie zur Rückzahlung ihrer Verpflichtungen brauchen, wirkt sich das direkt auf die Wirtschaft insgesamt aus.
Es
war also in der Geschichte der Marktwirtschaft nicht einfach Geld,
das die dramatischen Entwicklungslinien der Wirtschaft, der
Geldwirtschaft und der Technik im engeren Sinne betrieben hat. Es war
Schuldner-Investiv-Kapital, oder wie Binswanger schreibt, die
Kreditgeldwirtschaft, die als eine „Geldschöpfung
aus dem Nichts (…) vor 400 Jahren bei Londons Goldschmieden
begann.“
Kritiker
behaupten, diese Geldschöpfung aus dem Nichts habe nie
stattgefunden und vermitteln gerne ein Bild einer konservativen
Geldwirtschaft, in der die Menschen ihre Ersparnisse auf die Bank
bringen, woraus die Bank dann wiederum Kredite vergibt. So
einleuchtend dieses Bild auch sein mag und so sehr es als Bild der
„schwäbischen Hausfrau“, die auch nur einmal jeden
Euro ausgeben kann einleuchten mag und zudem sympathisch wie
moralisch hochwertig erscheint, wären Schulden ja darin nicht
möglich, so sehr irrt der Glaube daran und so falsch ist das
Bild gegenüber dem, was es abzubilden scheint.
In diesem Bild ist jedem realen Wert ein realer Gegenwert zugerechnet. Geld repräsentiert als ‚money proper‘ einen Wert der Arbeit oder einen unternehmerischen Mehrwert. Aber schon bei der Bestimmung dieses ‚kalkulatorischen‘ Werts wird es schwierig und man spricht eher vom ‚money of account, also von einer Geldeinheit, die als Münze nicht geprägt bzw. als Papiergeld nicht ausgegeben ist, sondern lediglich als Einheit bestimmt wurde, nach der zu leistende Zahlungen verbucht werden, vom Buch- oder Verrechnungsgeld.
Eine Theorie, ohne dieses Buch- oder Verrechnungsgeld„ist falsch und steht unserem Verständnis des ökonomischen Prozesses im Weg“, so Binswanger. Wachstum und der damit verbundene materielle Wohlstand sind das Ergebnis von Investitionen, die wiederum künftige Produktionen und Dienstleistungen ermöglichen. Das Geld dafür stammt aus Krediten, und diese Kredite nicht aus Sparvermögen. Es stammt gewissermaßen also aus dem Nichts.
Man geht hinein in die Bank, erhält eine Menge Geld gut geschrieben und nichts Reales wurde dafür verbraucht; wie wir sagten, es wurde etwas belastet, einer weiteren Kreditvergabe nominell und zeitlich begrenzt entzogen. Der Vorteil dieser Methode liegt auf der Hand: Um Neues zu schaffen, muss man nicht sein vorhandenes Vermögen einsetzen oder dafür sparen, was den Konsum einschränken würde und bereits geschaffenes Vermögen bzw. Eigentum wieder zu ‚money proper‘ machen würde. Diese Kredite aus einer Kreditgeldwirtschaft schaffen faktisch „Geld aus dem Nichts“ (Binswanger), sie sind somit zusätzliches Geld, mit dem man wiederum mehr kaufen, neu investieren kann und das den Verkäufern wie den Banken über die Zinsen wiederum mehr Einnahmen beschert.
Technik – residual?
Unter den Produktivkräften und für das Wachstum einer Volkswirtschaft in einem zugleich materiellen, hier technischen, wie montetären Sinne hat die technische Entwicklung einen erheblichen Anteil. Wir haben diesen mit Schumpeter im Bereich zwischen 40 % und 60 % am Wirtschaftswachstum notiert, gleichwohl wir meinen, dass solche Berechnungen je nach Blickrichtung stark schwanken können. Dass aber der Anteil der Technischen Entwicklung an der Produktivität eine Volkswirtschaft erheblich ist, ist augenfällig und unstrittig.
Gleichwohl wird der Technischen Entwicklung innerhalb der wissenschaftlichen Tradition der Ökonomik ein lediglich „residualer Faktor“ zugebilligt. Das beginnt bei Marx, der ihr eine, wenn auch nicht ganz unwichtige Rolle im Begriff des „relativen Mehrwerts“, also bei der Erhöhung seiner Produktion durch die Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit zubilligt, um dann bei Schumpeter begrifflich als „Residuum“ oder „Restgröße“ direkt bezeichnet zu werden, gleichwohl die Technische Entwicklung eine wichtige Quelle für Produktivitätssteigerung und Wirtschaftswachstum ist und allein der Technische Fortschritt ein langfristiges Wirtschaftswachstum ermöglicht.
Bei Marx wie bei Schumpeter und allen anderen Ökonomen steht die Betrachtung der Technischen Entwicklung unter dem intellektuellen Vorbehalt einer Zweck-Mittel-Betrachtung. In dieser Betrachtung steht die Technik und ihre Entwicklung, wie wir bereits angesprochen haben, unter der Sichtweise, dass Technik als eine Form der Instrumentalisierung ökonomischer Prozesse erscheint, als komplexe Werkzeugform des praktischen Menschen in seinen ökonomischen Zusammenhängen.
Der Nutzen für den Menschen ist der Zweck, zu dem Technik als Mittel seiner Realisierung erscheint. Gesamtökonomisch betrachtet ist der Technische Fortschritt dynamisch effizient, da aufgrund der Nutzen- im Sinne der Produktivitätssteigerung weitere Anreize zu Innovationen gesetzt werden und im Zusammenspiel mit dem Lernkurveneffekt und der Humankapitalakkumulation die Technische Entwicklung stets auch eine, im postiven Sinne des Nutzens Entwicklung von Mensch und Gesellschaft impliziert. Allein der Klang dieser Begrifflichkeiten schmerzt das Ohr. Die Frage bleibt trotzdem, ist Technik überhaupt mit einer Bestimmung von Zweck und Mittel, von Nutzen und seiner Realisierung angemessen bestimmt? Und was ist dann der Nutzen im individuellen wie gesamtökonomischen Sinne?
Unsere Antwort lautet: Nein. Technik hat nicht allein einen für den Menschen bestimmten Nutzen. Technik muss bestimmt werden als eine Realisierung einer für den Menschen neuen Möglichkeit. Technik macht etwas möglich, was ohne Technik nicht möglich wäre. Wir fliegen heute um die Welt. Wir bewegen uns schneller, als es uns unsere biologischen bzw. physisologischen Voraussetzungen erlauben; bewegen mehr an Masse, sehen weiter als in den mikroskopischen Bereich, hören Frequenzen, die ohne Verstärkung unhörbar blieben. Selbst das Hintergrundrauschen des Urknalls zu repräsentieren ermöglichen technische Apparaturen.
Technik ist also weit mehr als eine Zweck-Mittel-Relation oder Nutzenfunktion. Als Zweck-Mittel-Relation kommt Technik erst in der Bedeutung eines individuellen wie eines gesamtökonomischen Nutzens ins Spiel, wenn ihre Ermöglichung, also ihre Potenzialität in die Umsetzung kommt; um mit Kant zu sprechen: in der praktischen Vernunft. Bis dahin ist die Technik resp. die Technische Entwicklung eine Frage der „Theoretischen Vernunft“, oder anders gesagt, eine ideelle Angelegenheit. Sowohl, was die Idee eines einzelnen „Erfinder“ wie die wissenschaftliche Grundlagenforschung mit staatlichen oder halbstaatlichen Mitteln, also unter staatlicher Forschungsförderung betrifft.
Technik
hat also ihren ontologisch fundamentalen, ihren prinzipiellen
Charakter in der menschlichen Vorstellungskraft, ohne die Technik
überhaupt nicht wäre. Ihr Sein ist somit vorgestellte
Ermöglichung von etwas neuem, die Grenzen der menschlichen
Physiologie und Biologie sowie der menschlichen Praxis in Hinblick
auf den Umgang des Menschen mit der Natur und unter einander zu
überschreiten.
Erst in ihrer gesellschaftlichen Form, also in
der Nutzung von Technik im Rahmen bestehender, politischer,
rechtlicher und ökonomischer Bedingungen, wird Technik zum
„Gestell“17 .
Wir werden an geeigneter Stelle zur Technikphilosophie und zu Martin
Heidegger zurückkommen; so viel aber bis hierhin sei schon
gesagt, dass wir der Hypostasierung von Technik, ihr also eine eigene
„Energie“, eine immanente Kraft zur Veränderung von
Mensch, Natur und Gesellschaft zu zu schreiben nicht folgen werden.
Es
ist richtig, wenn Heidegger etwa wie später auch Habermas der
Technik insgesamt einen Einfluss auf das Denken wie den praktischen
Umgang des Menschen mit Natur und untereinander zusprechen. Allein,
eine der Technik inhärente „Gesetzmäßigkeit“
davon abzuleiten, der zufolge die Gefahr, dass „die
Nutzung eine Vernutzung“
wird und die Technik nur noch „ihre
eigene Ziellosigkeit zum Ziel hat“
(GA 7, S. 87 f.) können wir nicht zustimmen.
Natürlich
ist der Mensch der, der „die Dinge stellt“ und nicht die
Technik an und für sich. Es ist seine Vorstellungskraft
und seine Form der Realisierung im Rahmen gesellschaftspolitischer
und ökonomischer Verhältnisse; was denn sonst?
Denken, dass „Technik ist das Gestell“, die den Menschen einerseits zum Herrn der Erde sich aufschwingen lässt, anderseits durch die Verkehrung des Zweck-Mittel-Verhältnisses vom Gestell entmachtet und zum bloßen Moment des alles umspannenden technischen Prozesses werden lässt, billigt der Technik und dem Technischen Fortschritt eine „Seinsdimension“ zu, die einmal eine mysteriöse Unmittelbarkeit und zum anderen eine eben solche Gefahr einbildet, die aber ein einigermaßen wacher Geist schnell durchschaut.
Was Heidegger anspricht und auch in einem ZDF-Gespräch mit Richard Wisser von 1969 verdeutlichte (s.u.), ist der „unkritische“ Umgang mit der Technischen Entwicklung; also nichts mysteriöses, nichts eigengesetzliches, nichts unveränderbares. Biotechnologie bzw. Biophysik, die „Verwüstung der Erde“, die „Atomkraft“ und welche Beispiele man noch anführen möchte, sind, schrecklich in ihren potenziellen wie realen Auswirkungen auch immer, weit davon entfernt, einem schicksalhaften Prozess eines im Menschen verankerten „Wesens“ oder einer in der Technik selbst impliziten Gesetzmäßigkeit zu folgen.
Es ist richtig, wenn Philosophie die Technische Entwicklung wie Heidegger es grundsätzlich unternimmt, nicht aus dem Verhältnis von Zweck und Mittel denkt. Aber von Technik, im Unterschied zu einem traditionellen Werkzeug auszugehen und diesen Unterschied darin zu sehen, dass Technik für ihren Arbeitsprozess eine von menschlicher Arbeitskraft unabhängige Energiequelle nutzt und damit auch einen davon unabhängigen Bewegungsablauf hat und somit zugleich einen Herrschaftscharakter, der von der modernen Technik ausgehe, zu unterstellen (GA 7, S. 87 f.), ist nachgerade philosophischer Unfug und mindestens von Marx auf einer deutlich höheren intellektuellen Ebene bereits dargelegt. Nicht nur, dass dies bereits dann zum tragen, pardon, zum Ziehen käme, wenn ein Pferd vor einen Karren und ein Ochse vor einen Pflug gespannt wird; die Parallele zum aristotelischen Gedanken der Kraft der Veränderung aus sich selbst heraus, die er der Natur im Unterschied zum Menschen zuspricht, ist in diesem Kontext fehl am Platze.
Dazu kommt, dass die Gefahr, die vom Gestell ausgeht, dass also die Technik uns in ihren Kontext stellt, und diese Gefahr so zugenommen habe, dass der Mensch kaum noch hinter das durch Technik „verstellende Wesen des Seins“ zu blicken in der Lage ist, dass also eine Art „Metaphysik der Technik“ uns beherrscht, ist ebenso ein Holzweg des Denkens, auf dem der Existenzialismus in seiner fundamental-ontologischen Form umher wandelt. Von welcher Gefahr sprechen wir? Von der Gefahr, dass Technik, die uns ubiquitär umgibt, versagt, dass die Brücken, über die wir gehen oder fahren zusammenstürzen? Es ertrinken mehr Menschen Jahr für Jahr beim Baden im Rhein als durch einstürzende Brücken, die über den Fluss führen, gleichwohl das Gefühl der Angst darauf, also eine Brückenphobie, wahrlich kein schönes Gefühl ist.
Von
der Gefahr, dass uns mit jeder neuen Form von Technik ein Wissen
verloren zu gehen droht, das der Mensch einmal hatte, heute aber
nicht mehr braucht, weil der praktische Kontext nicht mehr existiert,
sprechen wir davon?
Nach
Heidegger geht nicht nur Wissen verloren, sondern sogar ein
höherwertiges Wissen, ein Seinswissen, von dem man aber wenig
bestimmtes erfährt, außer, dass es auf Wahrhaftigkeit,
Ursprünglichkeit und Schlichtheit gründet. Man könnte
auf die Idee kommen zu meinen, dass dieses ominöse Wesen des
Seins einer nationalen Kultur und Ästhetik, einem esprit
herméneutique
nahe kommt, in dem das ‚Ältere‘ zum Unmut des
‚Jüngeren‘ diesem stets vorzuziehen sei. Sich so mit
einer Mystifizierung der Geschichte des Altertums, speziell der
Geschichte der antiken, griechischen Philosophie ab Platon zu umgeben
markiert wahrlich keinen wirklichen Unterschied, wird doch das
verstellende Wesen der Technik lediglich durch das verstellende Wesen
des Altertums ersetzt.
Wenn
man mit Begriffen wie Gefahr argumentiert, dann muss man diese auch
benennen, und man kann sie auch benennen, sonst trifft einen selbst
das verstellende Wesen dessen, worüber man spricht und man geht
selbst wie die von der Technik geblendeten Menschen auf
Holzwegen:„Sie
gehen in die Irre: aber sie verirren sich nicht.“
Ein
schönes Bild einer psychoneurotischen Erkrankung, einer Phobie,
zwar ist das eines Holzweges, der in die Irre führt, ohne sich
zu verirren – wie soll ein Weg dies auch bewerkstelligen, außer
in einer psychoneurotischen
Wirklichkeit. Aber um psychologische Phänomene soll es ja nicht
gehen, wenn von
Technik im Sinne des Gestells die Rede ist. Und dass das Gefährliche
der Gefahr eine umfassende Verstellung eines anderen Seinszuganges
als der mittels Technik wäre, bleibt unbündig argumentiert.
Denn, wenn Technik ihren Ursprung oder Anfang nicht in sich selbst trägt, sondern im aktiven Denken18 , dann wäre dieses Denken selbst schon am Grund seiner Bestimmung verstellend; eine eigenartige Synthese von sinnlicher Anschauung und normativem Denken, dessen Normativ die Entwicklung von Technik selbst wäre. Technik, darauf liefe es hinaus, müsste als eine Form des „Wirklichen innerhalb des Wirklichen“ erscheinen, deren Zusammenhänge nicht nur impersonal und konstitutiv, also wirklichkeitsbestimmend wären, sondern auch schwer zu verstehen; wenn überhaupt.
Technik wäre so betrachtet natürlich nicht residual. Technik wäre- und dies ist dann auch folgerichtig konsequent gedacht, metaphysisch, hätte also den Status einer Metaphysik, der es um die „letzten Fragen“ der Menschheit ginge. Warum ausgerechnet Philosophen, eine Philosophie der Technik, die in der „Auseinandersetzung mit dem Wesen und der Geschichte der abendländischen Metaphysik“ mehr Klarheit ins metaphysische Dunkel der Technik, tiefere „Einblicke in das, was ist“ bringen könnte, als alles bisher da gewesene, bleibt bislang noch unkonkret, ist doch der Folgeband von „Sein und Zeit“ bislang nicht öffentlich. Grundsätzlich aber steht zu bezweifeln, dass ein rückwarts in die Geschichte der Metaphysik gewandtes Denken einen hermeneutischen Horizont für die die Technischen Entwicklungen der Menschheit bzw. ein wenig tiefer gehängt, ab der modernern Form der Industrialisierung menschlicher Arbeit zu leisten in der Lage ist; mindestens das müsste Technikphilosophie leisten.
Anmerkungen:
1 Binswanger(2015)
2 Vgl. dazu und das Folgende Wikipedia.
3 Vgl. Philip Daileader (2007): The Late Middle Ages. audio/video course produced by The Teaching Company, ISBN 978-1-59803-345-8.
4 Die Flagellanten oder Geißler waren eine christliche Laienbewegung im 13. und 14. Jahrhundert. Ihr Name geht auf das lateinische Wort flagellum (Geißel oder Peitsche) zurück.(Wikipedia)
5 Vgl Johannes Arndt (2009): Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam Sachbuch, Stuttgart
7 Enzyklopisches Lexikon für das Geld-, Bank- und Börsenwesen. 1967/68, S. 1654.
8 Disagio, Damnum oder Abgeld ist der Betrag, um den der Kurs einer Münze, Banknote oder eines Wertpapiers unter dem Nennwert liegt bzw. im Finanzwesen ein Abschlag vom Nennwert, der bei einer Kreditgewährung oder der Ausgabe eines Wertpapier oder von Sorten vereinbart werden kann. Das Gegenteil des Disagios ist das Agio oder Aufgeld.
9 Bank of England Act 1998 (Memento des Originals vom 15. April 2012 auf WebCite) Bank of England Act 1998 PDF Ebenso: Kurm-Engels, Handelsblatt, 18. Mai 2006, S. 27.
10 Collins, Christopher: The Oxford Encyclopedia of Economic History, Volume 3. BANKING: Middle Ages and Early Modern Period. Oxford University Press, 2012, S. 223
11
Horst Fischer: Geld und Banken. 2002,
S. 73.
12 Hans-Joachim Jarchow: Theorie und Politik des Geldes. 11. Auflage. Verlag Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2003, S. 326.
13 Das bezeichnet eine Geldwirtschaft, in der neben dem Bargeld (Noten, Münzen) auch noch Buchgeld existiert. In der Literatur wird manchmal auch die unterschiedliche Art der Geldschöpfung aus Zentralbankgeld und Kreditschöpfung durch Privatbanken in diesen Begriff einbezogen.
14 W. E. Jackson: Southern Economic Journal, Vol. 60, No. 4, April 1994. S. 1078–1080. ISBN: 9780865976313
15 Ludwig von Mises: Human Action: A Treatise on Economics. In: The Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama. 1998. S. 570.
16 Hayek (1976)
17 Zur Technik und dem Begriff: Gestell vgl. Martin Heidegger: Vorträge und Aufsätze. GA 7, S. 18. Sowie ders. in: Hölderlins Hymne »Der Ister«. GA 53, S. 54. Sowi: GA 7, S. 87 f und GA 7, S. 24. Ebenso ZDF-Gespräch vom 25. September 1969. In: GA 16, S. 706. Und Spiegel-Interview in Reden und Zeugnisse. GA 16, S. 679.
18 Wir werden uns später mit dem Ausdruck: aktives Denken im Rahmen der Aristoteles Rezeption noch beschäftigen.
zurück ...
weiter ...
Ihr Kommentar
Falls Sie Stellung nehmen, etwas ergänzen oder korrigieren möchten, können sie das hier gerne tun. Wir freuen uns über Ihre Nachricht.